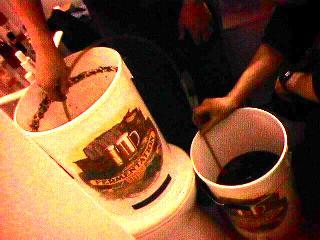Heimbrauen für Anfänger: Eine schmerzlose Anleitung
Einführung
Dieser Text ist als schnelle Einführung für diejenigen gedacht, die mit dem Gedanken spielen, sich einmal als Heimbrauer zu versuchen aber sich vielleicht bis jetzt noch nicht getraut haben oder denen es zu kompliziert erscheint.
Mit dem Heimbrauen ist es wie mit dem Musikgeschmack: Es führen viele verschiedene Techniken zum ersten Bier, aber den absoluten Pfad oder den Königsweg gibt es nicht. Ich beschreibe im folgenden meine eigenen Erfahrungen, die ich beim Brauen meiner ersten 20 Liter gemacht habe und möchte diese natürlich nicht als die einzig richtige Art und Weise hinstellen, sondern nur als Beschreibung, wie man leicht und einfach 2 Kisten gut schmeckendes Selbstgebrautes herstellt.
Was brauche ich?
Die Einstiegskosten für die erste “Lage” sind nicht allzu hoch, sie liegen bei ca. 100DM. In Deutschland ist Heimbrauen wg. der hohen Qualität kommerzieller Biere nicht sehr verbreitet wie z. B. in den USA, es für den Biertrinker schon fast überlebenswichtig ist, sein eigenes “Brew” anzufertigen, um sich nicht mit “Buttwiper” oder ähnlichen Industrieabfällen vergiften zu müssen.
Von daher müssen wir i. d. R. auf den Versandhandel zurückgreifen, wenn man nicht das Glück hat, einen Heimbrauladen um die Ecke aufsuchen zu können. Meine Anfängerausrüstung habe ich von der Firma Krupka-Niemann bezogen, deren Service als auch Preis m. M. nach sehr gut sind. Mit der “Minibrauerei” bin ich sehr gut bedient, und die Firma nimmt die Ausrüstung bei Nichtgefallen bis 6 Monate nach dem Kauf sogar noch zurück.
Im Preis inklusive ist ein “Bierkit” (gehopfter Malzextrakt) der Firma Glenbrew, das man sich frei nach Geschmack aus dem angebotenen Sortiment aussuchen kann. Ich habe mich für das “Chairmans Trophy Bitter” entschieden, eine britische Alesorte, die relativ schnell zubereitet werden kann.
Als extrem praktisch haben sich außerdem der Flaschenabfüllstutzen (ca 10 DM) und die Folienthermometer (ca. DM 15) für die Gäreimer herausgestellt, die man gleich mitbestellen sollte.
Zubereitung der Bierwürze
Der erste Schritt auf dem Weg zum eigenen Bier ist die Zubereitung der Bierwürze, zu der die Hefe bei richtiger Temperatur dann zugegeben wird. Diese Würze wird duch Auflösen des Malzextraktes in Wasser und anschließendes Kochen erzeugt. Hierzu brauchen wir
- 20 Liter kaltes Wasser
- Die 6-Pfund-Bierkit-Dose + beiliegende Trockenhefe (liegt bei)
- Kochlöffel zum Umrühren (möglichst sauber und aus Plastik)
- 12,5 Liter-Topf (Edelstahl) oder Einkochgerät mit eigenem Netzteil
- Desinfektionsmittel “Chempro SDP” (liegt der Minibrauerei bei)
- Erster Gäreimer (22.5 Liter Inhalt, liegt bei)
- ein sauberes Wasserglas für die Hefe sowie Alufolie zum Abdecken
Als Erstes desinfizieren wir den ersten Gäreimers durch Auffüllen mit kaltem Wasser und Zugabe von 5 TL Chempro SDP (mitgeliefertes Desinfektionsmittel). Alles weitere, was noch desinfiziert werden soll (z.B. Kochlöffel, Litermaß, Hefeglas, Eimerdeckel) wird einfach mit in den Gäreimer gesteckt.
Etwas abgekochtes Wasser + 2 TL Malzextrakt aus der Dose sollte man auf handwarme Temperatur in einem sauberen Glas abkühlen lassen, um damit später die Hefe “anfüttern” zu können.
Während dieser Zeit kann man das Wasser für die Bierwürze (ich habe 4.5 Liter genommen) bereits in den 12-Liter-Topf geben und auf Stufe III (E-herd) vorwärmen. Nach dem Öffnen der Malzextrakt-Dose wird der Inhalt zugegeben (die Dose anschliessend mit heissem Wasser auswaschen und den Rest der Würze hinzugeben) und durch gutes Umrühren mit dem Kochlöffel mit dem Wasser im Topf vermischt. Hierbei sollte man darauf achten, daß kein Sirup am Topfboden kleben bleibt, was man durch gutes Umrühren erreicht.
Nun wird es einige Zeit dauern, bis die Würze zum Kochen gebracht ist, schließlich handelt es sich ja um recht viel Flüssigkeit. Auf unserem Herd habe ich dazu ca. 30 Minuten gebraucht und öfters mal umgerührt. Diese Zeit können wir nutzen, um den ersten Gäreimer vorzubereiten. Die desinfizierten Teile einfach beiseite legen und den Eimer mit kaltem, klarem Wasser ausspülen, um evtl. vorhandene Reste der Chlorlösung zu entfernen. In diesen Eimer füllt man dann ca. 10 Liter Wasser, zu dem nachher die heiße Würze zugegeben wird. Ich habe den Eimer dann mit dem Deckel abgedeckt mitten in die Küche auf ein paar Handtücher gestellt. Auf jeden Fall sollte man auf Sauberkeit achten, also den Eimer nicht mehr innen berühren, nachdem er desinfiziert wurde.
Sauberes Arbeiten ist der einfachste, aber auch wichtigste Schritt auf dem Weg zu einem guten Bier!
Als nächstes steht die “Rehydrierung der Hefe” auf dem Plan. Die mitgelieferte Bierhefe ist sog. Trockenhefe, d.h., in Pulverform vorhanden. Damit sie sich in der Würze möglichst schnell und gut vermehrt, ist es ratsam, sie durch Zugabe von Wasser und ca. 2 TL Malzextrakt-Sirup bereits in die “Startlöcher” zu schaffen. Der Inhalt der Hefetüte wird einfach ins abgekochte, handwarme Wasser + 2TL Malzextrakt-Sirup ins Glas geschüttet und dieses abgedeckt und lichtgeschützt abgestellt (also möglichst nicht in die pralle Sonne auf der Fensterbank).
Inzwischen sollte die Bierwürze Kochtemperatur erreicht haben. Auf kleiner Flamme / Stufe wird die Würze nun für 40-50 Minuten gekocht, wobei man darauf achten sollte, daß einem der ganze Kram nicht überkocht (also Umrühren, ein gutes Auge auf den Inhalt haben und nicht zuviel Feuer geben! 😉 Nach ca. 5 Minuten Kochzeit gibt es den “Hot Break” zu bewundern, bei dem der Topf gerne auch mal überkocht, also ist in dieser Zeit besondere Aufmerksamkeit angebracht.
Der heisse Topfinhalt wird nun in das kalte Wasser im Gäreimer gegossen. Anschließend wird der Eimer noch auf 18–22 Liter mit kaltem Wasser aufgefüllt, je nachdem, ob man ein stärkeres oder ein schwächeres Bier haben möchte ,und dieser leicht abgedeckt (z. B. durch loses Auflegen des Deckels) und abgekühlt (z. B. in einem Kaltasserbad in der Wäschewanne und durch Abkühlen auf dem Balkon bei kühlen Außentemperaturen).
Über die Rechtmäßigkeit dieses Schritts (das “brutale” Abkühlen der Würze in kaltem Wasser) streiten sich die Autoren, mein Bier hat trotzdem sehr gut geschmeckt, und wir wollen ja ein einfaches Bier brauen, oder?
Zugeben der Bierhefe: Ist die Temperatur der Mischung im Gäreimer auf unter 26 Grad Celsius abgefallen (nach ca. 30–40 Minuten), können wir die Bierhefe zugeben, in dem wir einfach den Inhalt des Wasserglases (er sollte inzwischen reichlich schäumen) in den Gäreimer giessen und evtl. noch mit einem desinfizierten Kochlöffel leicht umrühren. Das wars! Der erste (und bei weitem aufwendigste) Schritt zum eigenen Bier ist getan.
Nun wird der leicht verschlossene Eimer in eine ruhige Ecke gestellt, damit die Gärung bei ca. 19–21 Grad ihren Lauf nehmen kann. Nach ca. 48 Stunden sollte sich ein schöner Schaumkopf (der sogenannte “Kräusen”) gebildet haben, der dann später ins Bier zurücksinkt, sobald die Gärung an Intensität nachläßt. Allerdings sollte man der Neugierde widerstehen und nicht zu oft in den Eimer schauen (also den Deckel anheben), um das Infektionsrisiko durch Bakterien oder wilde Hefe in der Luft möglichst klein zu halten.
Abziehen des Jungbieres
Nach ca. 3 bis 4 Tagen sollte man das Bier vom ersten Gäreimer in den zweiten umfüllen (zu Deutsch “Abziehen”, auf Englisch auch “Racking” genannt), um die Verunreinigung des Bieres mit toter Hefe oder auch bitteren Stoffen gering zu halten. Dies erreichen wir mit der selben Methode, mit der man auch Benzin aus Nachbars Auto klaut: Dem Schlauchsyphon.
In diesem Schritt benötigen wir:
- ca 1,5 Meter sauberen Plastikschlauch (gibts im Fachgeschäft für ca 60 Pfennig / Meter)
- Gärventil+Gummiverschluß (liegt der Minibrauerei bei)
- den zweiten Gäreimer (mit dem Abfüllhahn, der nach Anleitung montiert wird, liegt bei)
- Desinfektionsmittel Chempro SDP (liegt bei)
- Kleines Auffanggefäß (Schale oder ähnliches)
Auch hier wird nach bereits bekanntem Schema vorgegangen: Zunächst wird der zweite Gäreimer desinfiziert (also wieder mit kaltem Wasser aufgefüllt bis an den Rand und 5 TL Chempro SDP zugegeben). Alle weiteren benötigten Teile werden in den mit der Lösung gefüllten Eimer gelegt und somit ebenfalls desinfiziert.
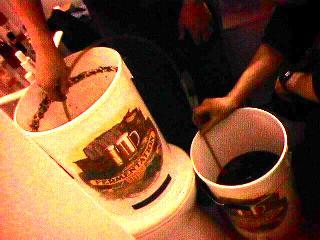
Während die Lösung für 20–30 Minuten einwirkt, kochen wir etwas Wasser ab (zum Auffüllen des Gärventils) und holen den ersten Gäreimer mit dem Jungbier aus seiner stillen Ecke, um ihn auf auf einen etwas erhöhten Ort zu stellen, von dem aus wir das Bier umfüllen können (bei mir war das das Klo im Badezimmer, aber ein stabiler Stuhl oder Küchentisch tut’s natürlich auch 😉
 |
Nun spülen wir den desinfizierten Gäreimer mit kaltem Wasser aus und stellen ihn unterhalb des mit Bier gefüllten Gäreimers auf, also z. B. auf den Fußboden. Danach öffnen wir den vollen ersten Gäreimer (nicht erschrecken, es stinkt und sieht wirklich fürchterlich aus!) Der saubere Schlauch wird nun blasenfrei mit Leitungswasser aufgefüllt und die beiden Enden mit den sauberen Daumen fest verschlossen. Keine Angst, es geht nur um Bier! |
Jetzt geben wir das obere Ende des Schlauches schnell ins Bier, senken das untere Ende in ein bereitgestelltes Gefäß (z.B. Schale) und starten die Bierpipeline, indem wir den anderen Daumen vom unteren Schlauchende nehmen. Nachdem das Wasser aus dem Schlauch in das Auffanggefäß geflossen ist und Bier kommt, wird der zweite Eimer damit aufgefüllt. Dabei ist darauf zu achten, das es nicht platscht und plätschert, sondern das Bier ruhig und ohne viel Tamtam in den zweiten Eimer kommt.
Das Bier sollte immer aus der Mitte des Flüssigkeitsstandes geholt werden, damit nicht die Bitterstoffe von der Oberfläche und auch nicht die Sedimente aus dem unteren Bereich des ersten Gäreimers mit abgezogen werden. Die letzten 3–4 Zentimeter Flüssigkeit lassen wir weg, dieser Verlust belohnt uns mit einem wohlschmeckenden Bier.
Der zweite Eimer mit dem umgefüllten Bier wird nun mit Hilfe des Deckels fest verschlossen, der Gummistopfen mit dem Gärventil eingesteckt und dieses bis mindestens zur ersten Kugel des Gärventils mit abgekochtem Wasser gefüllt. Der Eimer wird nun für 7–10 Tage an einen ruhigen, warmen Ort gestellt (ebenfalls 19–21 Grad). Ich hatte zunächst hektische Aktivität im Gärventil erwartet (also Blubbern, Blasen, etc.), aber nichts dergleichen fand statt. Keine Sorge, das scheint normal zu sein! 😉
Den ersten Gäreimer sollte man so bald wie möglich gründlich mit klarem Wasser ausspülen, um sich beim nächsten Bier nicht mit festgesetzten Sedimenten herumschlagen zu müssen.
Die Flaschenabfüllung
Nun ist es nicht mehr weit bis zum ersten Hausbräu! Die Wartezeit der zweiten Gärung vertreiben wir uns auf angenehme Weise mit dem Leeren von zwei Kisten voller 0.5-Liter Bügelflaschen (Der Autor bevorzugt hier “Detmolder Pils”, da es keine andere Sorte vor Ort in 0.5-Liter-Flaschen gibt, als Norddeutscher möge man sich mit “Flensburger Pils” oder ähnlichem vergnügen). Schafft man es nicht allein, sollte man sich Hilfe holen, außerdem macht allein Trinken sowieso häßlich, wie wir alle wissen.
Die Flaschen werden nach der Leerung sofort ein- bis zweimal mit klarem Wasser und Schütteln ausgespült, die Verschlußgummis abgezogen und aufbewahrt. Die Flaschen werden dann anschließend auf dem Kopf stehend in der Kiste getrocknet, damit keine Flüssigkeitsrückstände in der Flasche bleiben.
Nach 7–10 Tagen im zweiten Gäreimer kann die Flaschenabfüllung beginnen. Hierzu werden benötigt:
- 30–40 0.5-Liter Bügelflaschen (sauber)
- ein kleiner Kochtopf mit 0.5 Liter Wasser
- ein kleiner Kochtopf zum Kochen der Flaschengummis
- ein Pfund Malzextrakt in Pulverform, dunkel oder hell, oder
- alternativ Zucker (yuck!!!!)
Ich rate auf jeden Fall von der Verwendung von normalem Zucker ab, man sollte sich also gleich bei Bestellung der Minibrauerei ein Pfund trockenes Malzextrakt mitbestellen, Krupka-Niemann berät hier gern!). Die Verwendung von Zucker ist nicht problematisch, aber verstößt gegen das Reinheitsgebot, und dann könnte man natürlich gleich zu einer Flasche “Buttwiper” oder “Millers” greifen und sich den ganzen Aufwand sparen!
Je nachdem, wieviel Bier sich noch im zweiten Gäreimer befindet (so 18 bis 20 Liter), kocht man eine 3/4 bis ganze Tasse Malzextrakt in 0.5 Liter Wasser für 15-20 Minuten auf und kühlt den Topf im Wasserbad auf handwarme Temperatur herunter. Diese Mischung gießt man dann in den zweiten Gäreimer. Nicht über den Geruch im 2. Gäreimer erschrecken, ist ganz normal! Danach verschließt man den Eimer wieder und wendet sich der Desinfektion der Flaschen zu.
Während des Aufkochens des Malzextraktes und nach Zugabe ins Bier werden die Flaschen im Backofen bei 120–130 Grad für 15–20 Minuten sterilisiert und die Flaschengummis für 10 Minuten im Wasserbad gekocht. In unseren Backofen passen 16 Bügelflaschen (aufeinander gestapelt, Flaschenboden zur Klappe). Die Seitenwände des Ofens und der Backrost sollten mit Backpapier ausgelegt werden, um direkten Kontakt zwischen Glas und Metall zu vermeiden (Gefahr des Springens?)
Nachdem die Flaschen abgekühlt sind, kann mit der Abfüllung begonnen werden. Dazu bietet sich entweder der mitgelieferte Schlauch mit Klemme (nicht dabei) oder aber der Flaschenfüllstutzen an (gleich mitbestellen, ca DM10). Das Bier sollte ohne Plätschern und Schäumen in die Flaschen gefüllt werden, bis etwa an den unteren dicken Wulst des Bügelflaschenhalses (also ca. 2–4 cm Luft in der Flasche lassen).
Nachdem der zweite Gäreimer leer ist, wird er gesäubert und die Kisten mit dem abgefüllten Bier für ca. 2–3 Wochen bei Zimmertemperatur aufrecht gelagert. Behält man etwas Bier in einer nicht ganz gefüllten Flasche übrig, können Abenteurlustige mal einen Schluck riskieren, man sollte sich allerdings seelisch auf ca. 15 verschiedene Nachgeschmäcker innerhalb von 3 Minuten einstellen (so wars jedenfalls bei meiner Lage). Nach 10 Tagen kann bereits probiert werden, allerdings wird der Kohlensäuregehalt nicht allzu hoch sein. Besser ist, man zügelt sich noch ein bis zwei Wochen.
Es ist soweit!


Nachdem die Flaschengärung ausreichend fortgeschritten ist, geht’s an den lustigen Teil! Das Homebrew sollte vorher ca 30–60 Minuten im Kühlschrank (ebenfalls aufrecht, damit das Sediment nicht aufgewirbelt wird, z. B. in der Tür!) gekühlt werden. Die Gläser sollten, falls sie aus der Spülmaschine kommen, mit heissem Wasser ausgespült werden, da sonst der Schaumkopf des Bieres relativ schnell zusammenfallen kann. Das Bier wird nun in einem Schwung (bei einem 0.5-Liter-Glas) in Glas gegossen, wobei je nach Schaumbildung vorsichtiger oder kräftiger gegossen werden sollte, aber was erzähle ich euch, wie man ein Bier eingießt? ;-). Auch hier sollten die letzten 1-1.5 cm in der Flasche bleiben, um einen allzu hefigen Geschmack durch ins Glas gelangte Hefesedimente zu vermeiden.
Dann: Mund auf, rein damit und ordentlich probieren! Und das selige Lächeln nicht vergessen! Prost! Das Bier sollte sich auf jeden Fall bis zu 6 Monate aufbewahren lassen, und in angenehmen Gegensatz zu kommerziellem Bier wird es immer besser, da durch die in der Flasche enthaltene Hefe immer noch Gäraktivität stattfindet.
Dank, Abschließendes & Literatur
Ich stehe in keiner Verbindung mit der Firma Krupka-Niemann, abgesehen von der Tatsache, daß ich ein zufriedener Kunde bin und die einfache Bestellmöglichkeit und Recherche über Netz sehr schätze. 😉 Darum auch vielen Dank an Hibbo von K.-N., der mir stets telefonisch und per e-mail bei Fragen zur Seite stand! Die Fotos stammen freundlicherweise von Helga Schoening und ihrer neuen Digitalkamera.
Weiterhin bezieht sich die hier vorgestellte Vorgehensweise auf das o. g. “Trophy Bitter”, die Zubereitung anderer Sorten kann natürlich andere Ergebnisse produzieren, aber im großen und ganzen sollte man mit jedem vorgehopften Bierkit einigermaßen wohlschmeckende Resultate erzielen können.
Rechtliches: Da wir in Deutschland leben, wo es leider nicht nur gutes Bier, sondern auch haufenweise Vorschriften, Verfügungen, Gesetze, Bürokraten und andere Freaks gibt, ist nicht nur das Legen von befruchteten Nymphensitticheiern melde- und lizenzpflichtig, sondern natürlich auch das Brauen von Bier. Sagt also netterweise beim Zollamt Bescheid, wieviel ihr braut (20 Liter pro Person und Monat sind glaube ich frei), damit sich die Jungs ihre Flasche abholen können, und verkaufen dürft ihr’s auch nicht.
Literatur
Sehr geholfen hat mir Charlie Papazian’s Buch “The New Complete Joy of Homebrewing” (z. B. zu bestellen beim ABC Bücherdienst) und auch der FAQ “How to Brew Your First Beer”, Rev. D.2 von John J. Palmer (1994). Moralischen Support gab es reichlich von einem sehr versierten deutsch-amerikanischen Homebrewer, Udo K. Schürmann, dessen fantastisches Homebrew mich überhaupt erst auf diese (verrückte) Idee brachte. Sein “Walrus Hoppy I.P.A.” ist wirklich eine Reise über den Atlantik wert! 😉
Wer gern etwas ueber die “fortgeschrittene” Kunst des Heimbrauens erfahren moechte, erfaehrt im zweiten Teil mehr darueber!


 Welcome to my Astronomy pages. On the left, you can see the instrument I use for observing: A Super Polaris C8 which I bought from the States back in 1994 or so from wholesale optics of Pennsylvania, which later turned into “Pocono Mountain Optics” and then sadly went out of business, I believe.
Welcome to my Astronomy pages. On the left, you can see the instrument I use for observing: A Super Polaris C8 which I bought from the States back in 1994 or so from wholesale optics of Pennsylvania, which later turned into “Pocono Mountain Optics” and then sadly went out of business, I believe.